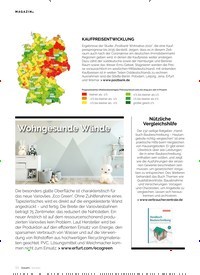WISSEN
Die Sonne unbeschwert genießen: In diesem Wohnbereich sorgt ein Klima-Innengerät, hier in Form eines Heizkörpers, für angenehme Abkühlung bei Bedarf. > www.daikin.de
Sommer, Sonne, Sonnenschein – allerdings haben die wenigsten von uns Freude daran, wenn in den eigenen vier Wänden rund um die Uhr ein tropisches Klima herrscht. Denn die unangenehmen Folgen von Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit können schlaflose Nächte, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit und Kreislaufbeschwerden sein. Von besonders hohen Temperaturen betroffen sind die Bewohner von Dachgeschossräumen.
Das wichtigste Ziel sollte es sein, die heißen Sonnenstrahlen vorausschauend so konsequent wie möglich abzuwehren, bevor sie ungebremst auf Fassade, Dach und Fenster treffen und dann rasch das Gebäudeinnere aufheizen. Dazu zählen insbesondere eine angepasste Architektur, ein hochwertiger Wärmeschutz sämtlicher Außenbauteile sowie ...