Resilienz
Wir sprachen mit Robert Leiderer, 60, psychologischer Psychotherapeut, über verschiedene Strategien gegen Hilflosigkeit und Kraftquellen der Zuversicht.
MAX: Wie gefährdet sind wir in diesen unsicheren Zeiten, unsere Resilienz zu verlieren?
Peter Leiderer: Die Frage ist, ob wir in unsicheren Zeiten mit Hilflosigkeit reagieren, also keine Strategie haben, um Probleme zu lösen. Ganz konkret: Wir haben keinen Einfluss auf die Situation in der Ukraine. Beim Klimawandel könnten wir auf alle Fälle mehr tun, aber wir tun es nicht. Wir lenken uns leicht ab, durch die Dinge, die in unserem Wohlstand allgegenwärtig und bequem sind.
MAX: Ist in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche die psychische Anfälligkeit größer?
Leiderer: Ich würde sagen ja, es hängt immer davon ab, ob wir Hilflosigkeit schon aus der Biografie erlernt haben. Wenn wir Ohnmacht ertragen, statt etwas zu tun, dann sind wir in ...






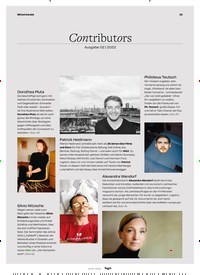

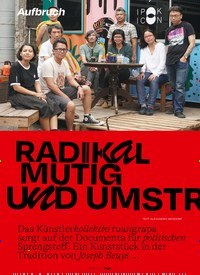
![WENN MEDIEN [SICH] IN DEN KRIEG ZIEHEN [LASSEN] WENN MEDIEN [SICH] IN DEN KRIEG ZIEHEN [LASSEN]](/images/default-article-cover-6_x2.png)