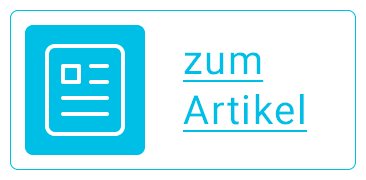Hadija Haruna-Oelker ist Politikwissenschaftlerin, Autorin, Moderatorin und Journalistin und lebt in Frankfurt am Main. Im März veröffentlichte sie ihr erstes Buch „Die Schönheit der Differenz. Miteinander anders denken“ (2022, btb). Wir sprachen mit ihr über die Lesbenbewegung, Schwarze Kämpfe in Deutschland und Verbündetsein.
L-MAG: Du hast früher selbst als Autorin für
L-MAG geschrieben. Welche Rolle haben lesbische Kämpfe in deinem Werdegang gespielt?
Hadija Haruna-Oelker: Ich selbst kann nicht aus der lesbischen Perspektive sprechen. Aber viele der Menschen, die mich werden ließen, wer ich bin, sind Schwarze lesbische oder queere Personen. Ich habe während meines Volontariats für L-MAG als freie Autorin im Musikressort gearbeitet und habe auch einmal über die Schwarze lesbische Holocaustüberlebende Gupha Voss geschrieben. In meinem Leben gibt es einen großen Anteil Schwarzer queerer Menschen ...