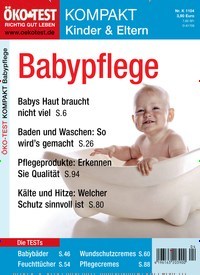Bei schönem Wetter bleibt niemand gern drinnen. Die pralle Sonne und größte Hitze sollte man allerdings meiden und niemals den Hautschutz vergessen. Denn Babys Haut hat praktisch keine Möglichkeit, sich selbst gegen die Sonnenstrahlen zu wehren.
Foto: Peter Mennen/Fotolia.com
Bis Kinderhaut einen ausreichenden Lichtschutz entwi ckelt hat, also genügend Melanin produziert und eine Lichtschwiele bilden kann, dauert es einige Jahre. So lange reagieren die Kleinen besonders empfindlich auf die UV-Strahlen. Das erste Gebot beim Sonnenschutz für Neubürger dieser Welt lautet daher: Raus aus der Sonne! Zehn ...