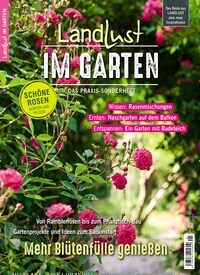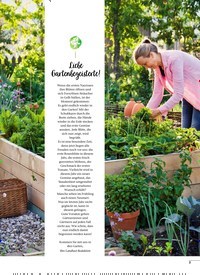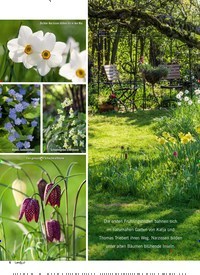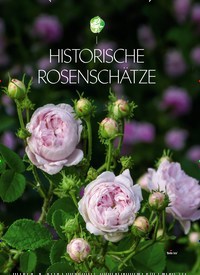Möhren lassen das Gärtnerherz höher schlagen. Nicht nur weil die Sortenvielfalt keine Wünsche offen lässt, sondern auch weil bei guter Planung von Mai bis zu den ersten Frösten im Herbst frische Möhren aus den eigenen Beeten geerntet werden können. Mit der Einlagerung von späten Sorten kann man das aromatische Wurzelgemüse auch im Winter genießen. Sicher sind gerade die ersten Frühmöhren aus dem Garten ein besonderer Genuss – allerdings stehen ihnen die späteren Rüben im Aroma nicht nach. Eher ist es so, dass die längere Reifezeit dieser Sorten die Entwicklung der Aromen fördert.
Aus drei Wildtypen gekreuzt
Die Vorläufer unserer heutigen Möhren Daucus carota ssp. sativus stammen nicht von der heimischen Wilden Möhre Daucus carota subsp. carota ab (s. Infotext Seite 74), sondern von zwei gelbfarbigen und rotvioletten orientalischen Unterarten aus Afghanistan und der im Mittelmeerraum vorkommenden ...