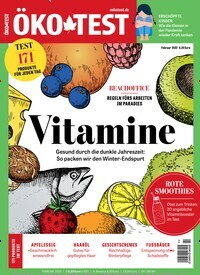Unterwegs arbeiten
Arbeitsrecht
Einfach auf brechen und sich bei der nächsten Videokonferenz aus dem Ausland von der sonnigen Terrasse mit Blick über die malerische Bucht zuschalten, macht nicht nur Kollegen neidisch. Es kann gegen den Arbeitsvertrag verstoßen. Denn der Arbeitgeber hat das Weisungsrecht, wo der Arbeitnehmer arbeitet und was mobil arbeiten bedeutet. Regelt der Arbeitsvertrag das nicht konkret, sollte der Arbeitnehmer sich von seinem Arbeitgeber eine Erlaubnis holen.
Lehnt der ab, muss das kein böser Wille sein, sondern kann an internationalem Recht liegen. Denn das Unternehmen muss aufpassen, dass es nicht unbeabsichtigt eine Betriebsstätte im Ausland gründet. Das zöge einen hohen Aufwand nach sich, von Steuern über Sozialabgaben bis hin zum Arbeitsschutz. In der Praxis hängt es vom Land ab, in dem der Arbeitnehmer sein Homeoffice einrichtet. Selbst innerhalb der Europäischen Union ...