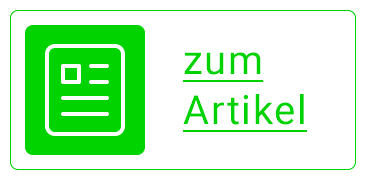So extrem wie hier in Hongkong ist es hierzulande zwar noch nicht, doch auch in deutschen Großstädten steigen die Kosten für Miete, Haus- und Grundstückskauf. Das spüren nicht nur Geringverdiener, sondern auch die Mittelschicht. Wohnungsprobleme sind die neue soziale Frage. Verdichtung und Neubau stellen Städte und Bewohner auch vor ökologische Herausforderungen.
Foto: Nikada/getty images
Wo Wohnraum knapp ist , stehen die Interessenten Schlange – wie hier bei der Besichtigung eines Neubauprojekts in Dortmund.
Foto: imago/Friedrich Stark
Begegnen sich zwei Menschen in Berlin. Fragt der eine den anderen: ...