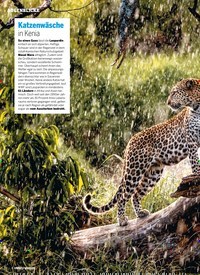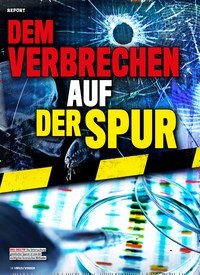Kaum ein Urzeitwesen fasziniert uns so sehr wie der Dinosaurier. Schon Kinder begeistern sich für die „gewaltigen“ oder auch „schrecklichen Echsen“, so die Übersetzung des aus dem Altgriechischen stammenden Namens der Tiere, die die Erde von der oberen Trias vor rund 235 Millionen Jahren bis zur Kreidezeit vor etwa 66 Millionen Jahren bevölkerten. Und die Faszination hält oft bis ins Erwachsenenalter. Als das Museum für Naturkunde Berlin von 2015 bis 2020 eines der wenigen Originalskelette eines Tyrannosaurus Rex (links zu sehen) zeigte, kamen rund drei Millionen Besucher aus allen Altersgruppen, um den zwölf Meter langen und vier Meter hohen Dino zu bestaunen. Voraussichtlich noch in diesem Jahr soll der auf den Namen Tristan Otto getaufte Publikumsmagnet erneut ausgestellt werden.
JEDES JAHR 500 KILO MEHR
Das enorme Interesse an den ausgestorbenen Giganten wird auch von immer neuen Erkenntnissen ...