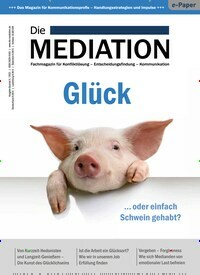Glück
Glück zu erforschen ist ziemlich schwierig – und im Grunde kaum oder gar nicht möglich. Denn Glück ist kein Gegenstand, den man dem Forscher vorzeigen, kein klarer Gedanke, den man zu Papier bringen kann. Glück ist ein seelisches Phänomen und zugleich ein körperlich-geistiger Zustand, ein Gefühl eben oder eine Stimmung. Man kann Glück haben – und das genau wissen, und man kann überglücklich sein – für einen kurzen oder langen Moment –, ohne es vollständig rationalisieren oder gar in Worte kleiden zu können. Aber man kann erforschen, was Menschen glücklich macht und was Glück für ihr Leben bedeutet.
In meinem langen Forscherleben war ich immer auf der Suche nach dem Glück. Ich merkte bald, dass es eine Überfülle an Glück-Zusammenhängen gibt, dass viele Glück-Gemeinsamkeiten in den verschiedenen sozialen Gruppen vorhanden sind, aber eben auch Besonderheiten, so etwa wenn man das Lebensalter ...