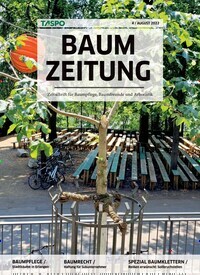„Ich möchte in unserer Stadt in den nächsten 20 bis 30 Jahren ein lebenswertes und attraktives Umfeld für unsere Bürger und Bürgerinnen schaffen. Deshalb ist es für mich wichtig, so viele Bäume wie möglich zu pflanzen. In einigen Jahren wird der Wunsch nach einem Schattenplatz noch größer als heute sein“, sagt Müller zu den Beweggründen der Stadt.
In den Jahren 2012 bis 2017 gab es im Stadtgebiet mehr Fällungen als Neupflanzungen. Vor diesem Hintergrund rief die damalige Umweltbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens von den Grünen 2018 die Aktion „Herzensbäume“ ins Leben. In Verbindung zum internationalen Tag des Baumes am 25. April 2018 startete die Aktion, um die Bewohner für ihre Stadtbäume zu sensibilisieren. Seitdem wird Erlangen mit viel Öffentlichkeitsarbeit noch grüner und lebenswerter. Heute laufen die Pflanzaktionen unter dem Namen „Aktion Stadtbäume“.
Baumradar
überprüft dann die ...