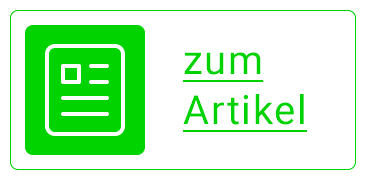Starkregen,Flutkatastrophen, Dürresommer und ein Massensterben der Bäume in unseren Wäldern: Die Zeichen stehen auch bei uns in Deutschland längst spürbar auf Klimakatastrophe. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wollen deshalb selbst einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wer beim Einkauf ohnehin auf Bio-Qualität und Tierwohl achtet, hat sich vermutlich längst gefragt, wie eigentlich die Klimabilanz der Waren im Supermarkt aussieht – wohl wissend, dass der durchschnittsdeutsche ökologische Fußabdruck weit über dem liegt, was angesichts der fortschreitenden Klimakrise noch irgendwie zu rechtfertigen wäre.
Dennoch haben die wenigsten eine Vorstellung davon, wann ein Produkt wirklich klimaneutral sein kann. Selbst konkrete Angaben zur eingesparten Menge CO₂ helfen da nur bedingt weiter, denn das klimaschädliche Gas ist eine kaum greifbare Größe für unseren Verstand. Es ist geruch- und farblos und ...