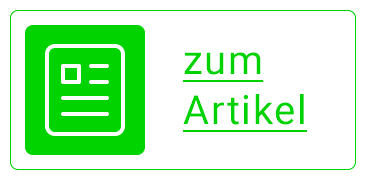Keime lauern überall. Doch wie sinnvoll ist es, sich mit antibakteriellen Seifen, Gelen und Tüchern dagegen zu wappnen? Experten halten wenig von deren Einsatz in Privathaushalten. Keines der getesteten Produkte kommt in unserer Bewertung über ein „befriedigend” hinaus.
Foto: b-d-s/iStock/Thinkstock;
Mal eben unterwegs die Hände desinfizieren, den heruntergefallenen Schnuller des Kindes abwischen oder die Toilettensitzfläche sauber machen: Produkte, von denen die Hersteller versprechen, dass sie antibakteriell wirken, sind in jedem Supermarkt-oder Drogerie regal zu finden. Nicht ohne Erfolg bauen die ...